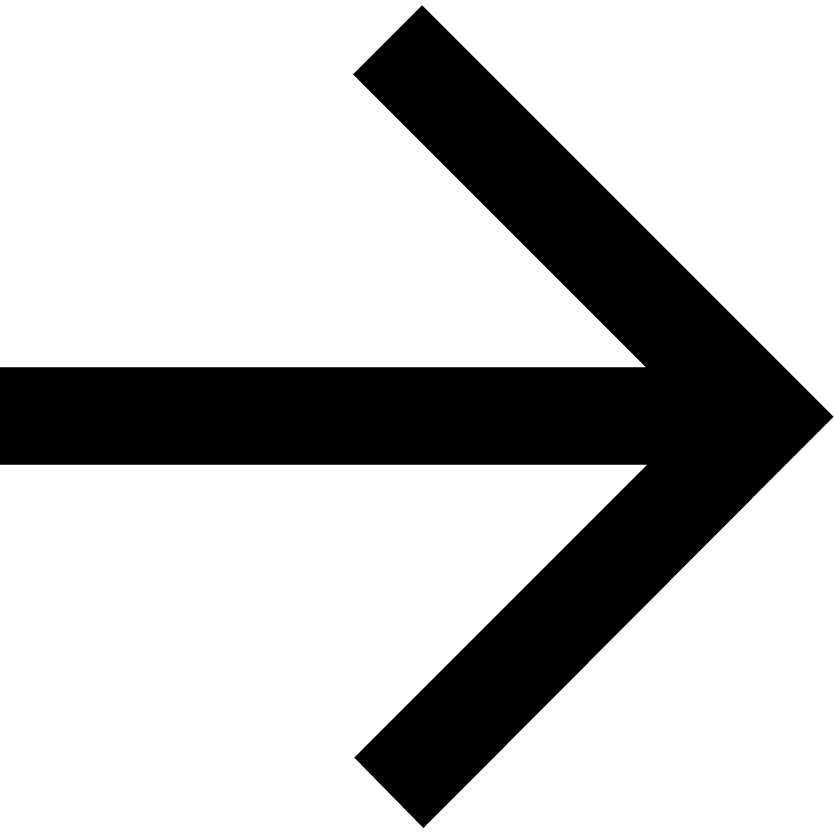John Smith
Being John Smith
12.9. – 16.11.2025
Was bedeutet es, in einer neoliberalen Gesellschaft, die das Außerordentliche predigt, „gewöhnlich“ oder unsichtbar zu sein?
In der englischsprachigen Welt ist „John Smith“ der generische Name schlechthin. Allein in Großbritannien tragen etwa 30.000 Menschen diesen Namen – zum Leidwesen eines jeden John Smith, der vielleicht seine Individualität hervorheben will. Dieses unlösbare Problem ist der Ausgangspunkt für Being John Smith (2024), den jüngsten Film von John Smith, einem britischen Künstler, der sich einen Namen damit gemacht hat, das Unspektakuläre in den Mittelpunkt zu stellen.
Das Werk umspannt Smiths Lebensgeschichte: von schulischen Fehlschlägen bis zu seinem Aufstieg zum Avantgarde-Filmemacher, von seiner Krebsbehandlung bis zu Reflexionen auf die Weltpolitik heute. Bild, Stimme und Text sind zu einer autobiografischen Betrachtung verwoben, in der es um nicht weniger geht als den Sinn der Kunst und des Lebens selbst. Trotz dieser gewichtigen Thematik setzt der Film auf Humor statt auf Pathos: eine manchmal politische, manchmal berührende Erkundung des Alltagslebens voller Ironie und Ehrlichkeit.
Smiths Filme entfalten sich am Kreuzungspunkt zwischen Konzeptkunst, structural film und Dokumentarfilm und drehen sich um sein eigenes Leben und unmittelbares Umfeld. In Being John Smith tauchen mehrfach rätselhafte abgedeckte Gebäude auf – ein surrealer Anblick, der doch sinnbildlich für die Lebensverhältnisse in Hackney in East London steht, wo Smith wohnt. In diesem stark gentrifizierten ehemaligen Arbeiterviertel kaufen wohlhabende Neuankömmlinge viktorianische Häuser und bauen dann oft die Dachgeschosse aus; die Planen, mit denen die Gebäude dafür zeitweise abgedeckt werden, sind kennzeichnend für diesen Wandel.
Dad’s Stick (2012), der zweite von drei Filmen, die in der Ausstellung zu sehen sind, ist Smiths Hommage an seinen Vater. Dazu zeigt er mehrere von dessen persönlichen Werkzeugen, um die Beschaffenheit von Erinnerungen und der Dinge, die Menschen hinterlassen, zu untersuchen. Darunter ist ein zum Umrühren von Farbe verwendeter Stock; ein Ende ist abgeschnitten, sodass zahlreiche Farbschichten wie Baumringe sichtbar werden, eine Zeitkapsel, in der über fünfzig Jahre persönlicher Geschichte verdichtet sind.
Über die Jahre hat sich Smiths Praxis entwickelt: Trat er schon früher oft in seinen eigenen Filmen auf, rückt er nun zunehmend autobiografische Einzelheiten in den Vordergrund. In seiner Ausstellung in der Secession knüpft er ein komplexes Gewebe persönlicher Ikonografie, das sich über drei Filme hinweg erstreckt und in das auch Fotografien und Gegenstände eingeflochten sind – darunter Bilder von ihm selbst und seinem Urgroßvater in ihren jeweiligen Werkstätten, Stumme Diener und Kaffeetischchen mit dem Titel Coffee Table Books, die er aus ebensolchen Bildbänden fertigt. Solche Querverweise treten allmählich in nachgestellten Szenen, Spiegelungen und Maßstabsverschiebungen zutage und wollen Schritt für Schritt entschlüsselt werden.
Dieselbe mehrschichtige und verzögerte Konstruktion von Sinn ist auch bezeichnend für The Black Tower (1985–1987). Der Film wechselt zwischen konventionellem Erzählen und visueller Abstraktion hin und her, mit Farbfeldern, die sich langsam in gegenständliche Bilder verwandeln. So baut er eine psychologische Bindung zwischen Erzähler und Zuschauer*in auf, während er immer wieder die Illusion durchbricht, indem er seine eigene Konstruktion in den Vordergrund rückt. Eine Stimme aus dem Off stellt einen Mann vor, der das Gefühl hat, dass ein Turm ihn durch London verfolgt. Die zugleich komische und verstörende Erzählung spitzt sich stetig zu einem horrorartigen Szenario zu, in dem der Protagonist die Fähigkeit verliert, zwischen Wirklichkeit und Übersinnlichem zu unterscheiden.
Mitte der 1970er ging es Smith darum, den Illusionismus des Mainstream-Kino in Frage zu stellen und die anscheinend zwischen Abstraktion und Gegenständlichkeit, zwischen Persönlichem und Politischem verlaufenden Trennlinien zu unterlaufen, ein Interesse, das er mit Kolleg*innen vom Royal College of Art, wo er studierte, und Mitgliedern der London Film-Makers’ Co-operative (LFMC) teilte. Von Anfang an war er auch von der Fähigkeit von Klängen – und insbesondere des gesprochenen Worts – fasziniert, Wahrnehmungen zu formen oder Bilder heraufzubeschwören. Smiths Handhabung von Bild, Ton und Text ist flexibel: Statt sie zu synchronisieren, arbeitet er mit Unterbrechungen und Störungen – und dazwischen mit viel Schwarzbild. Er erklärt: „Ich habe keine Angst vor Dunkelheit in Filmen, denn in ihr ist die Vorstellungskraft am Werk. Ton und Dunkelheit finde ich toll.“
Diese Herangehensweise ist in Being John Smith unverkennbar: Höchst persönliche Bekenntnisse zu Ängsten, Zweifeln und politischen Ansichten erscheinen nicht als gesprochene Monologe, sondern als Text auf dem Bildschirm. Dessen emotionaler Gehalt steht im Widerspruch zur Form des Einblendtitels mit seiner Aura von Objektivität und Autorität. Smiths ruhige Stimme dagegen führt uns ohne jede Emotionalität durch den Film.
Am Ende von Being John Smith sehen wir eine Menge von über 40.000 Menschen, die bei einem Pulp-Konzert den 1995 erschienenen Riesenhit der Band Common People mitsingen. Die Szene veranlasst zum Nachdenken nicht nur über Klassendynamiken, sondern auch über Gemeinschaftsgefühle und die affektive Macht der Kunst – darüber, was es bedeutet, zusammen zu sein, mit oder ohne einen nur allzu gewöhnlichen Namen.
Screening
John-Smith-Special im Österreichischen Filmmuseum
Samstag, 13. September, 18 und 20:30 Uhr, in Anwesenheit des Künstlers.
Im Verbindung mit seiner Einzelausstellung und in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Filmmuseum hat John Smith zwei Filmprogramme zusammengestellt, die man auf keinen Fall verpassen sollte. Gezeigt werden Arbeiten aus seiner gesamten Laufbahn, darunter der Kultfilm The Girl Chewing Gum (1976), Folgen von The Hotel Diaries (2001–2007) und Worst Case Scenario (2001–2003), der in Wien gedreht wurde.
In Kooperation mit dem Österreichischen Filmmuseum
Video
geboren 1952 in Walthamstow/London, UK, lebt in London, UK